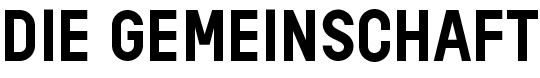100/200 Kitchen

Thomas Imbusch und Sophie Lehmann vom Restaurant 100/200 Kitchen in Hamburg im Gespräch über Gemeinschaftlichkeit, die Bedeutung von Esskultur und das konsequente Gehen neuer Wege.
Stellt euch bitte kurz vor – was für ein Unternehmen betreibt ihr und was sind eure Rollen dort?
S: Wir betreiben das Restaurant 100/200 Kitchen an den Elbbrücken in Hamburg, eigentlich kann man es aber besser als Küche beschreiben, weil es schon immer darum ging, den Fokus auf das Handwerk und Beisammensein zu legen. Das Restaurant ist Thomas‘ Lebenstraum, den wir 2018 zusammen verwirklicht haben. Wir führen das 100/200 seit Anfang an gemeinsam mit Thomas in der Rolle des Küchenchefs und mir als Restaurantleitung und Sommelière.
T: Ich bin nur am Kochen, Sophie kümmert sich um die gesamte Außendarstellung und alles was dazu gehört, um Geld zu verdienen.
S: Ja, im Laufe der Zeit bin ich auch die Marketingexpertin und die Bürotante geworden. Wir machen alles selber, was irgendwie mit dem Laden zu tun hat.
Was ist das Besondere am 100/200 Kitchen und was unterscheidet euch vor allem in Hamburg von anderen Lokalen?
T: Gelebte Esskultur. Wir kochen mit Herz und sehen uns als Sprachrohr zwischen Erzeuger*innen und Gäst*innen, genau das wollen wir auch jeden Tag zu erzählen. Daher auch der Name “100/200” – wir wollen, dass die Leute verstehen, worum es uns beim Kochen geht, nämlich darum, Wasser zu erhitzen und den Ofen anzuheizen, und nicht um irgendwelche hochtechnischen Apparaturen. Wir wollen das Thema Esskultur wieder zu dem machen, was es ist, nämlich elementar.
S: Wir verkaufen kein leeres Produkt, sondern bilden hier genau das ab, wofür wir selber stehen: Esskultur, Nachhaltigkeit, Dinge anders zu machen, jeden Tag. Wir wollen besondere Momente schaffen, durch die wir lernen und wachsen können.
T: Und wir arbeiten de facto ohne Industrie und ohne Handel, das ist ziemlich einzigartig. Wir ziehen das sehr stringent und hardcore durch, sodass wir im regulären Restaurantbetrieb morgens noch nicht sagen können, was es abends zu essen geben wird. Wir arbeiten nur mit kleinen Erzeuger*innen zusammen, greifen nur auf natürlich Ressourcen zurück – wenn der*die Jäger*in kein Wild geschossen hat, kann ich es halt abends nicht anbieten, das ist dann so.
Welche Motivation steckt dahinter, die Dinge
anders machen zu wollen?
T: Wie kann ich das Thema Esskultur wieder zu dem machen, was es ist, ohne dabei zu dogmatisch zu sein. Durch unsere Arbeitsweise haben wir einen viel engeren Bezug zu den Produkten, kommen mit Leuten in Kontakt, die wir sonst gar nicht kennenlernen würden. Aktuell sind wir zum Beispiel im Gespräch mit Leuten aus Dänemark, die ein Tonikum herstellen, das auf natürlich-fermentierter Basis beruht. Allerdings passt es geschmacklich noch nicht zu hundert Prozent.
S: Es ist zumindest kein klassischer Gin Tonic mehr. Bei solchen Schritten müssen wir uns dann fragen, ob wir uns mehr und mehr von Klassikern verabschieden wollen, wir bieten bereits auch keinen Rum und keine Cola mehr an. Die Gäst*innen haben allerdings oft ein eher klassisches Geschmacksbild, das kannst du mit unkonventionellen Kombinationen nicht befriedigen. Wir fragen uns daher laufend, wie und welche Alternativen wir schaffen können und wie wir uns damit fühlen, ob und wie sie zu uns passen.
T: Wir versuchen immer Alternativen anzubieten, anstatt zu sagen, dass es bestimmte Sachen gar nicht gibt. Nicht jeder versteht das, daher versuchen wir durch Ausgleichsprodukte so nah wie möglich an die Erwartungshaltung heranzukommen.
S: Aber nicht um der Alternative willen, sondern wirklich nur dann, wenn wir selber hundertprozentig davon überzeugt sind.
Welchen Stellenwert hat die Zusammenarbeit mit anderen
Betrieben für euch und wie habt ihr euch euer Produzent*innen-
Netzwerk aufgebaut?
T: Das Problem hier in Hamburg ist, dass im Zusammenhang mit Vereinen oder Initiativen total schnell der Begriff Greenwashing ein Thema ist. Es gibt hier unheimlich tolle Ideen und Konzepte, die es versuchen, richtig zu machen, trotzdem steht dann jeden Tag der LKW vom Großhandel davor und lädt seine Ware ab. Es gibt auch einige kleinere Markthallen, aber die hintergehen nicht nur ihre Kund*innen, sondern auch ihre Mitarbeiter*innen. Eine wirklich nachhaltige funktionierende Zusammenarbeit wäre eine Bereicherung, aber der Status Quo ist davon leider weit entfernt.
S: Die Suche nach Partner*innen und Menschen, mit denen wir arbeiten wollen und können, ist sehr mühsam. Auch wenn die Recherche ergiebig ist, heißt das noch lange nicht, dass die Zusammenarbeit dann reibungslos läuft. Versteht man sich, versteht der Gegenpart die Gastronomie, wie kommuniziert man miteinander? Wir hatten schon oft tolle Projekte an der Hand, wo im Nachgang dann leider doch herausgekommen ist, dass das Saatgut des kleinen biozertifizierten Hofes aus dem Monsanto-Katalog kam. Auch wenn der Hof in achtzehnter Generation geführt wird und noch so toll ist, sind es genau solche Sachen, die wir vermeiden wollen. Es ist ein tägliches Lernen, denn den Schlüssel zu guter, nachhaltiger Landwirtschaft und Esskultur gibt es nicht. Deswegen sind wir Teil der Gemeinschaft, um diesen zu finden und zu definieren. Da muss man sich auch mal aneinander reiben, vor allem aber auch Vertrauen aufbauen – und das ist aktuell in Hamburg noch mühsamer als in Berlin, in Hamburg ist der Gemeinschaftsgedanke innerhalb der Gastronomie leider überhaupt
noch nicht ausgeprägt.
T: Und es hat scheinbar keiner Interesse daran, das zu ändern. Es herrscht eine große kapitalistische Motivation vor, noch viel größer als in Berlin und wir sehen uns ständigen Fragen ausgesetzt wie “Ihr seid doch jeden Abend ausgebucht, seid erfolgreich, habt alle möglichen Auszeichnungen bekommen, die man bekommen kann – warum macht ihr das so? Warum investiert ihr so viel Geld in die kleinen Erzeuger*innen?” Unsere Antwort ist ganz einfach: Weil wir glauben, dass es nur so funktioniert.
S: Ihr könnt euch ja jetzt teure Weine leisten, warum nehmt ihr unbekannte Winzer*innen auf eure Karte? Warum Bio? Warum habt ihr keinen großen Bordeaux-Keller? Ja, wir könnten uns das alles leisten. Aber das ist überhaupt nicht das, worum es uns geht.
„Wir wollen das Thema Esskultur wieder zu dem machen, was es ist, nämlich elementar.“
Also ist innerhalb der Hamburger Gastronomie noch viel mehr Groundwork nötig, so klingt es.
T: Total.
S: Ja, weil ein grundsätzlich anderes Mindset bei den Leuten vorherrscht.
T: Gar nicht unbedingt bei den Gäst*innen, da ist es eher das ganze Gegenteil, die sind total aufgeschlossen.
S: Das ja, die Leute haben wirklich total Bock auf das, was wir ihnen anbieten. Aber das Netzwerk und das Untereinander, daran hapert’s noch. Auf Vorschläge, sich zusammenzutun und zum Beispiel mal ein ganzes Rind gemeinsam zu kaufen und zu zerlegen, den Platz haben wir hier ja, gab es bisher nur Ablehnung. So etwas funktioniert hier noch nicht.
T: Bis dato hat sich noch niemand der anderen Gastronom*innen dazu bereit erklärt, bei so etwas mitzuwirken. Aber man muss den Mut haben zu investieren, um früher oder später auch etwas zurück zu bekommen. So führen wir unser Unternehmen, wir versuchen immer nach bestem Wissen und Gewissen zu agieren und sind nicht darauf aus, aus einem Euro Einsatz drei Euro Gewinn zu machen.
Das klingt nach einem ziemlich steinigen Weg. Ergeben sich aus dem Status Quo denn auch Vorteile für euch?
S: Dadurch, dass keine geebneten Wege da sind, haben wir unheimlich schnell und viel gelernt. Du gehst in einen intensiven Austausch, lernst dich kennen, lernst Dinge, mit denen du dich sonst nie auseinandergesetzt hättest. Das ist sehr bereichernd und spannend. Der Pioniergedanke ist zwar oft anstrengend, aber wiederum auch sehr reizvoll, denn du kannst deine Erfahrungen dann ja auch wieder nach außen tragen.
Stichwort Austausch und Miteinander – ich würde gerne noch etwas konkreter auf Die Gemeinschaft eingehen wollen.
Warum seid ihr Mitglied der Gemeinschaft geworden?
S: Mit jedem Mal, dass uns Werbung von großen Konzernen begegnet, die mehr und lauter über Nachhaltigkeit spricht, als es die Landwirtschaft jemals tun kann und wird, ist uns immer klarer geworden, dass es nicht reicht, alleine im Kleinen etwas zu tun, sondern wir diese Themen in einer gemeinschaftlichen Form auf den Tisch bringen wollen, in der wir uns gegenseitig bereichern können. Das große Thema Esskultur wirkt sich auf so viele Bereiche des Lebens und der Wirtschaft aus, daher ist es uns enorm wichtig, unseren Teil dazu beizutragen, egal wie klein oder groß er ist.
T: Die Mitglieder der Gemeinschaft eint, dass es alles Leute sind, die unheimlich leidenschaftlich sind in dem, was sie tun, obwohl sie keine Plattform haben oder politische Unterstützung erfahren. Die Gemeinschaft bietet eine tolle Art des Miteinanders, die dafür sorgt, dass gastronomische und landwirtschaftliche Themen gehört werden, da das ganze System sonst irgendwann vor die Hunde geht. Und auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, ist es immer ein konstruktiver Austausch.
S: Letzten Endes wollen wir ja mit dem was wir tun verschiedenste Menschen erreichen, daher ist das Gemisch innerhalb der Gemeinschaft so wichtig, um eine gewisse Reibung zu erzeugen.
Gibt es Ziele, die ihr gemeinsam mit der Gemeinschaft erreichen wollt?
T: Es gibt eine romantische Destination unseres Lebens, wo wir uns sehen, wenn wir nicht mehr das tun können, was wir jetzt grade tun – und das ist, ein Kulinarisches Institut zu gründen. Das Ziel dieses Institut wäre es, den gesellschaftlichen Stellenwert aller gastronomischen, lebensmittelbezogenen Themen und Tätigkeiten zu erhöhen und die Grundbedingungen für gute Ausbildungen zu legen. Ein Institut, in dem es darum geht, Servicekultur, kochen, schlachten, Landwirtschaft, backen zu lernen – all das, was auch mit unseren Aufgaben als Gastronom*innen zu tun hat. Im Prinzip die ganz elementaren Dinge wieder wichtig werden zu lassen.
Um veraltete Strukturen aufzubrechen?
T: Unser Azubi erzählte uns letztens, dass sein Berufsschullehrer Lachs für 5,80 Euro das Kilo gekauft hat. Wie kann es sein, dass Leute für eine Packung Zigaretten knapp zehn Euro ausgeben, dann aber wiederum nicht dafür bereit sind, für ein Kilo Lebensmittel einen annähernd ähnlichen Preis zu zahlen? Davon müssen wir weg, diese Einstellung muss sich dringend ändern.
S: Der andere, etwas weniger konkrete Punkt ist, dass Esskultur ja immer mit allem zu tun hat – mit dem Umgang miteinander, der sich in Service und Kommunikation ausdrückt, mit Landwirtschaft, einem Verständnis von Nachhaltigkeit und Wertigkeit, einem gesundheitlichen Verständnis. Das sind so viele Themen, die sich gar nicht im Alleingang beantworten und abdecken lassen. Du brauchst Expert*innen für bestimmte Themen. Das erhoffe ich uns dadurch und sehe darin auch die Zukunft der Gemeinschaft – dass viele Leute mit vielen unterschiedlichen Schwerpunkten zusammenkommen und
alle davon profitieren können.
Weil eine vielschichtigere Ausbildung die Chance bietet, zu einem besseren Gesamtverständnis zu gelangen?
T: Genau das ist es! Denn du kannst nicht kochen, ohne zu verstehen, was Service bedeutet. Du kannst nicht anfangen, von dir zu behaupten, dass du ein großer Käse-Connaisseur bist, ohne die landwirtschaftlichen Strukturen dahinter zu kennen.
S: Man kann dann immer noch nach Talent und persönlicher Neigung spezifizieren. Aber es sollte erreicht werden, dass alle, die im Lebensmittelsystem arbeiten, ein gleiches Grundverständnis haben, um die Zusammenhänge zu verstehen.
T: So machen wir es ja bei uns bereits. Bei uns hat ein*e Küchenazubi*ne die Verpflichtung, auch im Service mitzuarbeiten und anders herum.
Wen wir uns jetzt nochmal etwas von dem lösen, was passieren soll und auf das schauen, was bereits passiert – würdet ihr sagen, es hat sich insgesamt im Lebensmittelsektor einschließlich Handwerk, Gastronomie, Landwirtschaft in den letzten Jahren etwas Positives getan? Wenn ja, an welchen Stellen konkret?
T: Was ich echt feststellen muss ist, dass die Lebensmittelindustrie derartig pfiffig unterwegs ist – die haben Apps entwickelt, mit denen du nur noch per Klick auf deinem Telefon alle Infos abrufen kannst. Also wenn du auf der Suche nach einem Schwein aus Bodenhaltung in Niedersachsen bist, erscheint auf deinem Display der*die Bäuer*in und liefert dir alle Details. Menschen, die sich dafür begeistern lassen, lassen sich auch bei uns im Restaurant darauf ein, dass wir an dem Abend im Prinzip machen können, was wir wollen. Nur so funktioniert unser Konzept, denn wir müssen uns ja von der Erzeugerschaft leiten lassen, was sie grade verfügbar haben und was grade gut ist. Diese Entwicklung nehme
ich persönlich wahr.
S: Man merkt in den Supermärkten, dass Dinge auf einmal ‘grün’ werden und es gibt ein viel größeres Bioangebot, als noch vor einigen Jahren. Ich sehe das allerdings mit einem gewissen Zwiespalt. Es passiert etwas, ja. Und vielleicht muss es auch erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber solange Menschen Nachhaltigkeit mit Unilever oder Nestlé assoziieren, wird es umso schwieriger, ihnen eine wirkliche Nachhaltigkeit und Wertigkeit der Lebensmittel nahe zu bringen. Zu viele fallen auf die grünen Logos und Verpackungen herein. Ob man diese Entwicklung gut oder schlecht nennen muss weiß ich nicht. Aber es ist ein Prozess im Gange, das definitiv. Das Bedürfnis, sich mit besseren Lebensmitteln auseinanderzusetzen, hat sich erhöht. Leider nutzt die Lebensmittelindustrie diese Erkenntnis ebenfalls für sich.
Welchen Vorteil haben Produkte kleinerer Erzeuger*innen in der Vermarktung?
S: Es ist überhaupt nicht schwer, etwas zu verkaufen, wenn ich voll und ganz dahinter stehe. Große Industriekonzerne haben natürlich ganz andere liquide Mittel, können es z.B. über Social Media viel breiter vermarkten. Wenn du mir 10.000 Euro die Woche in die Hand gibst, kann ich ganz andere Geschichten erzählen – was sie tun müssen, da die Produkte an sich nichts erzählen. Sie müssen erst in den Agenturen großer Konzerne aufgeblasen werden. Was wir ja aber erreichen wollen, ist eine langfristige, nachhaltige Veränderung, die wirklich den Menschen dahinter anspricht und nicht nur kurzfristige
Konsumentscheidungen auslöst.
Und an welchen Stellschrauben muss in diesem System noch am meisten gedreht werden? Gibt es eine Art Best Case,
den ihr euch wünsch?
S: Damit tue ich mich immer schwer. Ich bin eher so Typ Worst Case und arbeite mich von dort hin ins Positive. Was aber unser persönlicher Best Case sein sollte ist, dass wir nicht die Motivation an dem was wir tun verlieren. Dass das, was wir machen kein wahlloser Kampf gegen Windmühlen ist, sondern an jedem Tag zeigt, dass wir unseren Gäst*innen Impulse geben können, wie sie zu Hause, im ganz Kleinen, Dinge ändern können. Oder auch einfach nur ihr Geschmacksbild und Wohlbefinden zu sensibilisieren, weil ihr Körperempfinden ein anderes ist, als wenn sie Fast Food konsumiert haben. Und das lässt sich meiner Meinung nach nur durch positive Erfahrungen und persönlichen Kontakt erreichen.
Fotos
René Flindt
Text und Bearbeitung
Carolin Foelster