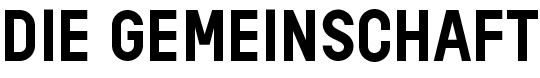Odefey & Töchter

Lars Odefey ist mit seinem Betrieb Odefey & Töchter seit der Gründung 2017 zu einem der wegweisendsten Geflügel-Züchter Deutschlands geworden. Seine Weidehühner vermarktet er nach eigener Hofschlachtung direkt an Köch:innen und Privatverbraucher:innen. Von der Schlupf, Aufzucht, Freilandhaltung bis zur Schlachtung verbringen die Tiere ihr ganzes Leben auf dem eigenen Hof in der Lüneburger Heide. Wir sprechen mit ihm über nachhaltige Fleischwirtschaft, die Zusammenarbeit mit der Gastronomie und die Entwicklung seines Betriebs.
Hallo Lars, stell dich doch mal vor und erzähl uns über Odefey & Töchter!
Ich bin Lars, 38, Landwirt und seit vier Jahren damit selbstständig. Ich habe mich 2017 dafür entschieden, aus dem Angestelltenverhältnis rauszugehen und den Hof meiner Eltern zu übernehmen, um mit der Zucht und Aufzucht sowie der Schlachtung von Geflügel – aktuell überwiegend Hühner -, anzufangen. Momentan habe ich ungefähr 3000 Hühner, ein paar Schafe und meinen Hund Lotti.
Was macht Odefey & Töchter anders als andere Hühnerbetriebe?
Mein Vater hat schon Hühner gehalten und wir haben gemeinsam überlegt, was ein Huhn eigentlich braucht, um ein gutes Leben zu haben: ein Huhn braucht Platz, braucht eine Stange zum Sitzen, braucht einen trockenen Stall, aber auch eine Wiese, viel Platz mit grünem Gras und dann auch ein bisschen Schatten und Platz zum Sandbaden. Gutes Futter spielt auch eine Rolle. Besonders wichtig ist aber vor allem Zeit. Wie immer, wenn gute Lebensmittel erzeugt werden sollen, braucht es genügend Zeit. Unser „schnellstes“ Huhn braucht dreieinhalb Monate und die langsamsten, das sind dann spezielle Rassen, brauchen ein halbes Jahr. Das ist ungefähr sechsmal so lange wie ein Standardhuhn aus dem Supermarkt.
Kannst du noch mehr dazu sagen, was den Unterschied zum konventionellen Huhn ausmacht? Warum sind deine Hühner vergleichsweise teuer?
Es fängt schon mit der Genetik an. Davon kannst du alles andere ableiten. Die Stallstruktur, die Lebenszeit sowie das Futter ist davon abhängig. Wir machen dabei eigentlich alles anders als die Industrie.
Wir haben z.B. Tiergruppen, also maximal 250 Tiere in mobilen oder festen Ställen. Damit haben die Tiere weniger Stress, weil sie sich innerhalb einer bestimmten Gruppengröße wiedererkennen können. In der Industrie sind es in der Regel 40.000 Tiere pro Stall. Also riesige Einheiten. Außerdem füttern wir von Hand anstatt in Futter-Automaten. Wir nehmen eine Schubkarre oder einen Eimer und tragen das Futter zu den Ställen und kippen es von Hand in die Tröge. Das gleiche gilt für die Tränken und für das Ausmisten. Kaum Technisierung oder Automatisierung. Das heißt, du siehst die Tiere. Ich bin mindestens dreimal am Tag bei ihnen. Morgens zum Füttern, rauslassen, Wasser auffüllen, Ställe versetzen. Nachmittags nochmal füttern. Abends die Klappen über Nacht schließen, wenn alle drinsitzen. Ich habe deshalb ein relativ enges Verhältnis zu den Tieren. Was ich cool finde, denn wenn du 40.000 Tiere in einem Stall hast, kann kein Mensch mehr den Überblick behalten. Das sind Hallen, groß wie Fußballfelder, aus denen die Tiere nie rauskommen. Komplett anonymisiert.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, als junger Mensch den Hof deiner Eltern zu übernehmen und alles „anders“ zu machen? Es ist ja auch eine Lebensentscheidung, die man trifft.
Ich war sieben, als wir von Schleswig-Holstein nach Uelzen gezogen sind. Ich habe vier Geschwister und wir hatten ein großes Haus mit viel Platz. Ich fand das als kleiner Junge cool und ich habe damals schon ziemlich viel mit meinem Vater gemacht: draußen Hütten gebaut. Mein Vater ist Jäger wie ich. Das haben wir zusammen gemacht und dann gab’s am Sonntag Rehrücken, den meine Mutter gekocht hat. Also das Thema Fleisch und dann Land- und Forstwirtschaft war schon immer präsent. Dann war ich 10 Jahre weg, weil Uelzen doch ein Kaff ist. Mit 18, 19, 20 denkt man sich „Okay, ich muss hier weg“. Ich hatte damals auch nicht die Vorstellung, dass ich wieder herkomme. Dann habe ich Öko-Landbau in Eberswalde und in Hohenheim studiert und war danach eine Zeit lang in Berlin und in Hamburg. Irgendwann kam der Punkt, an dem meine Eltern in Rente gingen und sagten: „Ja, wir wollen jetzt tatsächlich verkaufen,“ und sie hatten auch schon Makler da. Daraufhin habe ich ernsthaft darüber nachgedacht, ob es nicht doch gut wäre, hier etwas anzufangen. Zuerst dachte ich ausschließlich über ein Wohnprojekt mit gemeinschaftlichem Wohnen nach.
Ich bin dann 2014 wieder hergezogen, 2015 habe ich das Land dann übernommen und 2017, also relativ schnell im Anschluss, hab ich die Landwirtschaft wieder aufgegriffen und meinen alten Job gekündigt. Wie schon gesagt, ein bisschen Infrastruktur gab es hier schon: das Gebäude, das Kühlhaus, geflieste Räume für die Schlachtung.
War das von Anfang an der Plan, dass das Schlachthaus auch vor Ort sein soll?
Also bei mir auf jeden Fall wegen der Historie, wie ich sie kenne. Mein Vater hatte damals Gänse, Puten und auch Masthähnchen. Damals kamen sie noch aus Österreich. In der Steiermark haben wir die Küken abgeholt. Dann ist natürlich der Klassiker, dass du sie zu einem professionellen Schlachthof bringst, sobald sie fett genug sind. Da gibt’s ja nicht nur Wiesenhof und Tönnies, sondern auch noch ein paar Mittelständler. Dafür mussten wir zwei Stunden zum nächsten Schlachthof nach Nienburg an der Weser fahren. Ich konnte das damals, ich war 15 oder 16, noch gar nicht so richtig einordnen. Der Tod ist natürlich immer krass und nie banal. Ich wollte hier auf meinem Hof die Tiere nicht verladen. In der Regel passiert das abends. Dann stehen sie hier auf dem Hof rum, bis du morgens um vier die Fahrt beginnst. Auf dem Weg hast du die Straßengeräusche, dann werden sie von irgendwelchen Leuten geschlachtet – die kennen die Tiere nicht, und die Tiere sie nicht. Alles anonym. Im Anschluss kriegst du irgendetwas zurück. Du bekommst zwar dein Tier zurück, aber du weißt nicht, wie die Hygieneverhältnisse sind. Du weißt nicht, wie die Zuschnitte sind, du weiß nicht, wie sie ausgenommen wurden. Der letzte Schritt ist für die Fleischqualität essentiell. Wir schlachten hier ausschließlich unsere eigenen Tiere. Wir schlachten weder für jemanden extern, noch kaufen wir Tiere, um sie weiterzuverkaufen. Wir ziehen alle Tiere selber auf und schlachten und vermarkten nur unsere.
Stichwort Vermarktung: Wie arbeitest du mit anderen Betrieben zusammen, also zum Beispiel der Gastronomie und anderen landwirtschaftlichen Betrieben?
Da gibt es verschiedene Themen: es hat angefangen mit viel Klinkenputzen – Gastronomen aus dem Nichts anschreiben, dann dort hinfahren und sich vorstellen. Mein Vater hatte in Hamburg schon ein paar Kunden. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das ganze Thema Regionalität, insbesondere beim Geflügel ist wichtiger geworden. Die Spitzenköche und Köchinnen kaufen nicht mehr nur stumpf in Frankreich wie in den 70er und 80ern. Auch aus den verschiedenen Regionen Deutschlands kommen gute Produkte. Das hat sich verändert! Dieses enge Netzwerk hat in den letzten 5 bis 10 Jahren aufgrund der Klima- und Nachhaltigkeitsdiskussion Fahrt aufgenommen. Die Regionalwert AG’s oder Die Gemeinschaft sind daraus entstanden. Dieser enge Austausch heißt für mich, dass man relativ schnell direktes Feedback bekommt: wie war es für das Gegenüber? Wie hat das Tier geschmeckt, wie hat es den Kund:innen gefallen? Aus diesen Partnerschaften sind viele Freundschaften entstanden. Bei der Zusammenarbeit mit anderen geht es für mich viel um Wissen, aber auch um Spaß und Freude, Essen und Trinken.
Es hat sich seit deiner Gründung 2017 viel entwickelt: Du hast jetzt eine eigene Brutstätte und Du probierst viel mit verschiedenen Rassen herum. Wie kam es dazu?
Am Anfang hast du noch keinen guten Überblick, was es gibt und was man machen kann, was die Kundinnen und Kunden wollen. Dann machst du halt erst mal irgendetwas und schaust, ob das funktioniert. Und du hast einen initialen Plan, von dem du denkst, der geht auf. Aber es ist ja meist so, dass die Businesspläne irgendwie kaum deckungsgleich sind mit der Realität. Die Zucht war bei uns der ausschlaggebende Punkt, an dem wir etwas ändern wollten. Wir haben angefangen mit einer normalen Hybridkreuzung von Hühnern für die Fleischerzeugung aus dem Biobereich, weil es das Naheliegendste war. Dabei haben wir uns an Biokriterien orientiert, was den Platz, die Wiese, Stickstoff und Phosphoreinträge angeht. Das war zu dem Zeitpunkt auch okay. Wir waren eine kleinbäuerliche Manufaktur mit Hofschlachtungen. Aber wir hatten damit nicht wirklich den gewünschten Erfolg, weil es einfach zu vergleichbar war mit einem Biohuhn, das du irgendwann beim Biosupermarkt kriegen kannst. Gleichzeitig konnten wir sie nicht so günstig wie ein großer Biobetrieb mit 3000 – 5000 Einheiten und einem riesigen Schlachthof dahinter verkaufen. Weil wir einfach zu klein sind. Deshalb wurde klar, wir müssen irgendetwas machen, was keiner mehr macht, oder was es so noch nicht gibt. Wir suchten die „positive Einzigartigkeit“! Das ist bis heute so geblieben. Daher die Brutstätte und die verschiedenen Rassen. Dieses Jahr wollen wir Fasane gemeinsam mit dem Horvath in Berlin ausprobieren. Und Pute! Denn die Pute, ähnlich wie das Huhn, hat in Deutschland ein schreckliches Image. Sie hat so einen schlechten Ruf, dass man Pute gar nicht mehr essen will. Aber eigentlich ist Pute auch ein total gutes Produkt.
Ich habe auch das Gefühl, von der Pute gibt es immer nur die Brust.
Ja, die ist ja auch so gezüchtet. Also die macht irgendwie ein Drittel des Gesamtgewichts aus. Riesen Brüste, die irgendwie 1,2 Kilo wiegen, sodass sie am Ende gar nicht mehr laufen können. Und da ist die Konstellation im Hintergrund fast noch krasser als bei einem Huhn: ein Konzern liefert glaub ich über 90 Prozent der Putengenetik weltweit aus. Beim Huhn sind es immerhin noch drei. Einer aus den USA, ein Holländer und ein Deutscher.
Genau da haben wir dann weiter geschaut. Auch mit Leuten wie Thomas Imbusch und Micha Schäfer, die natürlich die Produkte, die wir erzeugt haben, auch bekommen und getestet haben. Dann hat sich das so stufenweise ergeben, dass wir angefangen haben….
Wie genau sieht denn dann so ein Prozess von Weiterentwicklung aus? Du arbeitest ja z. B. eng mit Gastronomen zusammen, unter anderem Mitgliedern der Gemeinschaft? Wie sieht so eine Partnerschaft und der Weg von der Idee bis auf den Teller aus?
Micha Schäfer, Küchenchef im Nobelhart und Schmutzig kannte ich schon. Rückblickend ist diese Partnerschaft über Jahre zu einer Freundschaft gewachsen. Es fängt damit an, stumpf eine E-Mail zu schreiben und zu hoffen, dass was zurückkommt. Ich kenne praktischerweise den Tagesrhythmus von Köch:innen. Der passt ganz gut zu meinem. Also bloß nicht vor zehn Aufstehen. Wenn die so langsam anfangen zwischen 10 und 14 Uhr – Kaffee trinken, die Vorbereitung machen, irgendwelche Sachen schnippeln, die Sachen vorkochen – dann rufe ich bei den Köchen an und sage: „Guten Morgen. Hier bin ich!“ Vielleicht hat man Glück, dann haben sie ein bisschen Zeit. Ich habe dann immer versucht, wirklich hinzufahren. Das persönliche Gespräch, auch wenn es nur über das Huhn ist, das man vorbeibringt, ist immer viel wert. Nach ein paar Tagen gibt es dann Feedback: Das Huhn war gut oder schlecht. Die Brust war so, die Keule war so. Was kann man machen? Was kannst du noch liefern? Wie ist der Preis? Bei Thomas Imbusch (100/200 kitchen) und Micha Schäfer (Nobelhart & Schmutzig) ist es mittlerweile so, dass es nicht nur Kunden sind, sondern auch so eine Art „Research-Team“. Wie ein partnerschaftliches Foodlab für mich. Das Tolle daran ist, wenn ich den beiden heute sage: „ich hab was Neues, wir haben jetzt ein blaues Huhn, das blaue Wunder von Mehre“ oder „wir haben jetzt Sulmthaler,“ dann sagt Thomas Imbusch immer sofort „Ja geil, nehme ich, schick mal Fünf – Zehn – Hundert“. Er vertraut mir und meiner Kompetenz und kauft das erst einmal und zahlt dann auch den Preis, den wir brauchen. Klar gibt es auch Grenzen. Aber in der Regel ist es so, dass man sich und die gegenseitige Arbeit respektiert. So wie er der Koch ist, respektiert er, dass ich der Bauer bin und die Hühner liefere und dann kochen die einfach damit. Es gibt ja so Leute, die müssen dann zehnmal Muster haben und sowas. Aber bei denen ist es so: Jo, alles klar. Du bist unser Partner für Huhn jetzt in diesem Fall, weil man dann weiß, man kann sich darauf verlassen und man ist dann ein Team. Und das ist echt cool.
Und es ist wahrscheinlich auch für dich von Vorteil, wenn man langfristige Partnerschaften hat?
Ja klar, ich arbeite viel lieber mit kleineren Betrieben. Ich habe Erfahrungen mit großen Ketten gemacht, die die Rechnungen nicht zahlen. Wo ich acht oder zwölf Wochen oder manchmal auch zwanzig Wochen auf mein Geld gewartet habe. Wir hatten Zahlungsausfälle mit der Rückmeldung, die Hühner waren zu klein. Sowas würde Micha Schäfer niemals sagen. Dieser Spruch, der in unserem Manifest steht – „Essen ist ein landwirtschaftlicher Akt“ –, der gilt dort eben wirklich. Das heißt, der Bauer oder die Bäuerin entscheidet mit, was auf dem Teller landet. Das ist eine komplett andere Denkweise als „Ich kaufe was ein, und am Ende kürze ich dem Lieferanten noch die Rechnung zurecht, weil die Ware nicht gepasst hat.“ Und das ist halt das Besondere und Coole. Prinzipiell ist es eigentlich das Beste, wenn man so ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann!
„Gemeinschaft kann alles bedeuten. Nur ein Gespräch. Es kann Austausch von Waren sein, es kann ein Praktikum sein. Und in der Gastronomie ist es schon länger ein Trend, weil Qualität und Nachhaltigkeit sich ergänzen und füreinander notwendig sind.“
Ich habe dich vorhin unterbrochenen in deiner Erzählung darüber, was sich geändert hat. Vor allem wüsste ich gerne mehr zu den Brutkästen.
Ja, richtig. Thema Qualität. Wir hatten unsere Biolinie und haben dann angefangen, selber Eier auszubrüten. Dann war relativ schnell klar: wir brauchen überhaupt erst mal Eier, also auch erstmal eine Quelle für die Eier der Rassen, die wir züchten wollen, und von denen wir glauben, sie bringen eine andere Qualität. Dann haben wir mit der Unterstützung des Nobelhart und Schmutzig und des 100/200 Restaurants Brutschränke angeschafft. Zwei Stück. Wir haben die Kosten gedrittelt, also ein Drittel Nobelhart, ein Drittel 100/200, ein Drittel Wir. Daraufhin haben wir etwa zehn verschiedene Hühnerrassen gekauft, im Brutkasten eingelegt und ausgebrütet. Das braucht erstmal ein halbes Jahr, bis sie zu den Köchinnen und Köchen geschickt und dann verkostet werden können. Wenn es dann Zuspruch gibt, schaue ich, ob es für uns überhaupt betriebswirtschaftlich Sinn macht. Der Prozess hat sich nun eingependelt, sodass wir seit letztem Jahr, also 2020, eine eigene Elterntierherde haben. Das sind 60 Hühner; 50 Hennen und 10 Hähne. Mit denen produzieren wir Eier, die wir dann selber ausbrüten und die Küken aufziehen. Aus denen wird dann für die Nachzucht weiter selektiert, um es möglicherweise mit anderen Rassen wieder zu kreuzen. Durch dieses neue Wissen und durch die neue Technik kommen wir nun in ein Stadium, bei dem wir sagen können: dieses Produkt ist einzigartig und gibt es nur hier.
Wie hast du dir dieses ganze Wissen angeeignet, das du jetzt hast?
Ich habe 14 Semester lang Landwirtschaft studiert!
Hast du in den letzten Jahren innerhalb unseres Lebensmittelsystems eine spürbare Veränderung erlebt? Sei es bei Konsumenten oder bei der Produktion oder im Handel.
Ja, man sieht es überall. In allen Gesellschaftsbereichen. In allen Themen, die eine Gesellschaft betreffen oder die bearbeitet werden. Also von Klima über Biodiversität, besonders in der Mobilität. Es ist höchste Zeit, dass wir im Thema Nachhaltigkeit vorankommen und wir viel, viel mehr machen. Es gibt Vorreiter, die das seit 50 Jahren machen. Die damals als Hippies abgetan wurden. Mittlerweile ist es selbst in eher konservativen Parteien angekommen, dass solche Themen wichtig sind für zukünftige Generationen. Und ja, es fängt dabei an, dass selbst die Menschen aus Uelzen, aus einer relativ einkommensschwachen, strukturschwachen Region, hier herkommen und sagen „Hey, ich habe seit 20 Jahren kein Huhn gegessen, weil das kann man ja nicht mehr essen. Aber ihres möchte ich mal probieren.“ Ich finde auch, das Thema Wohnen und das Thema Gemeinschaft ist bei vielen durch Corona verstärkt worden. Viele haben irgendwie so eine Sehnsucht. Diese ganze Individualisierung ist an einen Punkt gekommen, mit dem sich viele nicht mehr identifizieren.
Genau das ist ja auch der Begriff unseres Vereins: Die Gemeinschaft. Gemeinschaft kann alles bedeuten. Nur ein Gespräch. Es kann Austausch von Waren sein, es kann ein Praktikum sein. Und in der Gastronomie ist es schon länger ein Trend, weil Qualität und Nachhaltigkeit sich ergänzen und füreinander notwendig sind.
Aber wie siehst du das Thema, dass handwerklichen Lebensmittelhersteller:innen und der Gastronomie öfter mal unterstellt wird, dass es Luxusprodukte für eine sehr kleine Menge an Menschen sind.
Es soll nichts Elitäres oder Einmaliges sein, sondern der gesamte Markt und die gesamte Struktur muss anders funktionieren. Angenommen wir hätten dezentralere Strukturen, also alle 30-50 km einen kleinen Schlachthof. Der eine macht Schwein, der andere macht noch Rind und der nächste macht dann wieder nur Geflügel – und alles im besten Fall auf Höfen von Erzeugergemeinschaften, gegebenenfalls gemeinschaftlich betrieben. Mit 5 oder 10 Höfen reicht da eine Verarbeitungsstätte. Klar wird es teurer, aber es löst auch viele Probleme. Stichworte: Futtermittelimporte, Regenwald, Emissionen, Emissionen bei Transporten, Antibiotikaresistenzen, die ganzen Ausspülungen ins Grundwasser, die Überlastung der Gewässer und der Böden und am Ende auch die Auswirkungen auf die Menschen. Das ist aber eine Sache, die im Kopf stattfinden muss. Was ist mir wichtig? Muss ich dreimal im Jahr nach Malle fliegen und das neueste Smartphone haben? Ich glaube, der Preis würde viel regulieren. Wenn ein Hähnchen morgen nicht drei, sondern 12 Euro kosten würde, würde der Konsum zurückgehen und es würde vor allem auch mal einen Flügel oder eine Keule geben. Und auch Innereien würden wieder geschätzt werden, weil sie natürlich dann in Relation auch teurer werden.
Wen siehst du genau in der Verantwortung?
Eigentlich alle. Also jeder, der irgendwie im System herumwirtschaftet. Klar, auch die Politik, weil das bisher komplett fehlt. So langsam gibt es mehr Gelder in der Agrarförderung, in der zweiten Säule. Vorher waren diese Gelder stumpf flächenabhängig: Betrag x pro Hektar bewirtschaftete Fläche. Für Bio gab’s ein bisschen Aufschlag. Das fördert natürlich die großen Betriebe überproportional. Die Agrar-Umweltmaßnahmen, also ein bestimmter Wiesenschnitt, Grünlandpflege, Pflanzen von Hecken. Das ist alles irgendwie bis heute nicht so richtig doll gefördert und es muss viel mehr Unterstützung kommen. Auch viel mehr Geld für das Thema Verarbeitung oder regionale Marken. Es geht auch darum, diesen krassen Lobbyismus in Deutschland irgendwie ein bisschen auszubremsen. Ob auf Bundes-, auf Landes- oder auf Oberbürgermeisterebene.
Wenn du einen Joker für Veränderung hättest. Wie würde der aussehen?
Dann würde ich die Macht des deutschen Lebensmitteleinzelhandels zerschlagen. Denn die bekommen 40-50 Prozent des Preises, der von den Kundinnen und Kunden im Supermarkt bezahlt wird.
Und oft auch den Preis bestimmen.
Den Preis bestimmen und den Preis drücken. Was ja auch immer wieder mit der Marktstellung zu tun hat. Dass es nur noch Vier Händler gibt, die zusammen über 70 Prozent Marktanteil darstellen und nicht diejenigen sind, die das Lebensmittel erzeugen, sondern es vielleicht nur noch verpacken und dann in ihre schick ausgeleuchteten Regale packen. Dafür aber die Hälfte von dem ganzen Erlös bekommen. Das ist halt Kacke.
Kacke! Ja, schönes Schlusswort. Danke!
Fotos
Dinah Hoffmann, Hendrik Haase, Caroline Prange