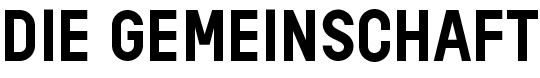Lode & Stijn

Lode van Zuylen und Stijn Remi betreiben zwei Restaurants in Berlin, in denen sie sich auf die Verarbeitung regionaler Erzeugnisse konzentrieren. Wie sich die Zusammenarbeit mit den Erzeuger:innen entwickelt hat, welche Erfahrungen sie in anderen Städten gemacht haben und worauf sich Gäst:innen in ihren Restaurants einlassen sollten, erzählen sie uns im Gespräch.
Hallo ihr beiden, stellt euch und eure Restaurants bitte kurz vor. Wie sieht eure Rollenverteilung aus?
Stijn: Wir sind Lode und Stijn und betreiben zwei Restaurants in Berlin, das Lode & Stijn in Kreuzberg und das Remi in Mitte. Das Lode & Stijn haben wir vor viereinhalb Jahren eröffnet, das Remi im Sommer 2020.
Lode: Vor zwei Jahren, als wir mit der Planung des Remi angefangen haben, hat sich auch unsere Rollenverteilung ergeben – Stijn kümmert sich um das Remi, ich kümmere mich um das Lode & Stijn. Vieles machen wir aber natürlich auch zusammen.
Was macht eure Restaurants aus und unterscheidet sie von anderen?
L: Ich möchte den Begriff no nonsense eigentlich nicht benutzen, aber es hat damit zu tun. Wir sind sehr persönlich und nahbar, man kann sich schnell mit uns verbunden fühlen – wir sind nicht Geschäftsführer einer Marke, sondern wir sind die Marke. Das Essen, das wir kochen ist sehr direkt und ehrlich, die Leute können es leicht verstehen. Und lecker (lacht). Es macht Spaß bei uns zu essen.
S: Das ist keine leichte Frage, weil man direkt an die Konkurrenz oder ähnliche Restaurants denkt. Aber das, was für uns wichtig ist, sind die guten Produkte und unsere Selbstverständlichkeit, dass das, was wir anbieten, immer gut sein muss. Das hat zwar seinen Preis, aber der ist immer gerechtfertigt.
L: Wenn man als Gast Lust hat, bei uns zu essen und mit einem open mind hier hereinkommt, wirst du einen richtig schönen Abend haben. Aber du musst mitspielen und uns vertrauen. Und bis zu einem gewissen Grad bereit dafür sein, dafür zu bezahlen. Dann hast du einen super Abend.
Und Inwiefern unterscheiden sich das Lode & Stijn und das Remi voneinander?
S: Mit dem Lode & Stijn haben wir ganz klar einen Weg über die Jahre geebnet – es ist eher eine Art Erlebnisrestaurant, in dem du ein von uns kreiertes Menü bekommst. Man geht hier nicht jeden Tag essen, vielleicht ein Mal im Monat, oder für besondere Anlässe. Das ist im Remi ganz anders – da kommen Leute sogar zwei Mal die Woche und es gibt à la carte. Im Remi kochen wir aber mit den gleichen guten Produkten, was unsere Kund:innen sehr schätzen.
Regionale, saisonale Produkte spielen in beiden eurer Restaurants eine große Rolle. Wieso habt ihr euch dafür entschieden, vorrangig mit kleinen Erzeuger:innen zusammenzuarbeiten?
L: Als wir angefangen haben, war unser Ziel nicht unbedingt, nur regional einzukaufen, das ist mehr ein Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung. Wir haben in anderen Städten Erfahrung gesammelt, dort war es überall möglich, relativ gute Zutaten über den Großhandel zu bekommen. Wir haben ein Pop Up-Dinner in den Niederlanden veranstaltet und außerdem in Stockholm, Prag, Hamburg und San Francisco gearbeitet. Die Niederlande ist logistisch gesehen eine große Stadt, denn du kannst überall alles bekommen. Und auch in allen anderen Städten war eine gute Basis vorhanden, wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass die Städte nicht 40 Jahre lang von einer Mauer umgeben waren und zudem vorher noch völlig zerstört worden sind. In Berlin war einfach überhaupt keine gute Infrastruktur für gute Lebensmittel vorhanden, nicht einmal für durchschnittliche. Mehr als Supermarktware war das nicht – wenn du hier in die Metro gehst, kannst du auch zu Rewe gehen. Daher mussten wir uns eigene Wege suchen, an Produkte heranzukommen, mit deren Qualität wir wirklich zufrieden sind.
Wie hat sich eure Zusammenarbeit mit den Erzeuger:innen im Laufe der Zeit verändert?
S: Im Lode & Stijn ist die Zusammenarbeit ja über die Jahre gewachsen, da baut man sich eine eigene Infrastruktur. Jetzt kommt zum Beispiel jeden Mittwoch David vom Erdhof Seewalde zu uns, um uns zu beliefern. Freitags Grete Peschken und der Lieferservice der Markthalle jeden Tag. In diese Zusammenarbet haben wir investiert, das hat Jahre gedauert. Wovon wir nun aber auch sehr für das Remi profitieren. Man kennt sich nun und kann auf die guten Sachen einfacher zugreifen. Der Unterschied beim Remi ist aber, dass wir für ein viel größeres Publikum kochen, hier arbeiten wir eher mit dem Lieferservice zusammen, weniger mit kleinen Erzeuger:innen.
L: Es hat sich in den viereinhalb Jahren auf jeden Fall sehr viel verändert, das ist schon ein riesiger Unterschied von heute zu damals. Es gab aber auf jeden Fall Momente, die auch schieflaufen – das gehört dann zu der Investition. Mit einigen Landwirt:innen liegt gar keine Planung vor, sondern es ist vielmehr eine laufende Planung. David sagt uns, wann er schlachtet und wir schauen dann, wie wir es einteilen können, was wir davon im Lode & Stijn und was im Remi brauchen. Dann gibt es andere, wie Küstlichkeiten, bei denen wir nach Kilo bestellen und unsere Präferenzen angeben. Die suchen für uns dann die beste Qualität. Damit diese Abläufe gut funktionieren, muss alles eingespielt sein, das dauert einfach.
Welche Hürden gibt es in der Zusammenarbeit mit kleineren Betrieben zu meistern?
L: Wir kamen aus Städten, in denen man abends die Bestellung aufgegeben hat und am nächsten Morgen stand es vor der Tür. Als wir nach Berlin kamen mussten wir feststellen, dass wir samstags unsere gesamte Wochenplanung abgeben mussten. Und das über alle möglichen Kanäle – dem einen schreibst du eine Mail, den anderen rufst du an, teilweise mit, teilweise ohne Bestellformular. Total unübersichtlich und sehr zeitintensiv. Manchmal macht man da Fehler oder dein Gegenüber macht Fehler. Oder irgendwo in der Lieferkette geht etwas falsch. Und was machst du, wenn du versehentlich keine Kiloware bestellt hast, sondern nur Stückware? Dann stehst du an einem Freitagabend da, hast viel zu wenig Produkte, wo holst du das dann her? Es gab da mal einen Abend, da musste ich Steinbutt in der Metro kaufen, weil wir zu wenig geliefert bekommen haben. Die Qualität des Fisches war so schlecht, so anders, als das, was wir sonst haben – das tat richtig weh, den zu schicken. Das Menü passte entsprechend überhaupt nicht mehr zusammen, hat nicht mehr funktioniert. Das passiert nur ein Mal, denn daraus lernt man.
Und welche positiven Aspekte bringt die Zusammenarbeit mit kleinen Erzeuger:innen mit sich?
S: Der wichtigste Punkt ist, dass wir nach den ganzen Jahren, die wir nun mit Produkten in dieser Qualität arbeiten, gar nicht mehr zurückgehen können. Sollte es die Produzent:innen und ihre Produkte nicht mehr geben, kann es auch unser Restaurant nicht mehr geben. Die Produkte bestimmen unsere Küche und unseren Stil zu kochen – das merkt man, wenn man hier isst.
L: Vor zwei Jahren haben wir ein Pop Up-Dinner in Amsterdam veranstaltet und haben vorher eine Liste der Dinge geschickt, die wir brauchen und betont, dass wir wirklich gute Ware brauchen. Als wir dort ankamen, hat uns nur Standardware erwartet, denn in deren Augen war es die beste Ware, die es dort gibt. Das war ziemlich unbefriedigend, ähnlich wie mit dem Steinbutt.
„Sollte es die Produzent*innen und ihre Produkte nicht mehr geben, kann es auch unser Restaurant nicht mehr geben“
Woher kommen diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen?
S: Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Man muss erstmal bereit dafür sein, höhere Preise zu zahlen, mehr Geld für die Ware auszugeben. Und dein gesamtes Konzept muss dann auch die Preise rechtfertigen. Viele Gäste, egal in welcher Stadt, sind da noch nicht bereit für.
L: Außerdem sind viele Gastronomen nicht unbedingt Küchenchefs, ihnen fehlt das Verständnis für die Ware. Die schütteln bei einem Wareneinsatz von 20% ungläubig den Kopf, denn ihr Einsatz liegt weit darüber. Das liegt vor allem daran, dass wir alles verwerten, sowohl bei Gemüse als auch bei tierischen Produkten.
Wie kann man die Zusammenarbeit zwischen Gastronomie und Landwirtschaft künftig stärken?
L: Ich glaube, dass man das gar nicht anders umsetzen kann, als sich zu treffen und persönlich zu sprechen. Vor kurzem waren wir auf dem Hof von Karen Schlegel, um dort Enten mitzuschlachten. Der normale Rupfprozess ist ziemlich grob, sie kommen zuerst in ein heißes Wasserbad, dann werden in einem speziellen Kessel die Federn gerupft, anschließend werden sie gewalzt. Die letzten Kiele werden durch eine heiße Wachsschicht entfernt. Eine der dreißig Enten hab ich trocken von Hand gerupft, das hat richtig lange gedauert. Aber das Ergebnis war ein totaler Unterschied: Durch die Hitze, der die Ente sonst ausgesetzt ist, verliert sie viel Fett. Das wirkt sich sehr auf die Qualität und den Geschmack aus. Zwei Tage später hat Karen mich angerufen, da sie sich nach einer Trockenrupfmaschine erkundigt hat. Das wäre nie passiert, wenn wir uns nicht getroffen hätten. Und auch wenn ich nicht alle zu einem Kochkurs zu uns einladen kann, sollten sie doch alle mal zu uns zum Essen kommen. Einfach um das Endergebnis, das wir hier kreieren, besser verstehen zu können. Und genauso sollten wir häufiger rausfahren, um zu sehen, wie die Landwirt:innen ihre Arbeit machen.
Stichwort Zusammenarbeit – gibt es Dinge, die sich für euch durch die Gemeinschaft verändert haben?
L: Es hat auf jeden Fall Sachen beschleunigt. Zum Beispiel, dass wir bei uns jetzt Dry Aged-Fisch machen. Wir haben viel Kontakt mit Ben aus dem Mrs Robinsons (Restaurant in Berlin, Anm. d. Red), er hat dazu beigetragen, eigentlich durch Zufall. Als uns der Fisch ausgegangen ist, habe ich ihn angerufen, ob er zwei Fische über hat. Er hat mir zwei trocken gereifte Wolfsbarsche gegeben, die waren richtig gut.
S: Ja, dieser Austausch untereinander ist echt gut und wichtig.
L: Ich sehe die Gemeinschaft als eine Art Treffpunkt, wie eine Art Marktplatz. Auf dem drei unterschiedliche Welten zusammengebracht werden – Gastronomie, Landwirtschaft, Gemeinschaftsverpflegung. Wir müssen noch mehr an einer gemeinsamen Vision arbeiten und uns fragen, was unser Ziel ist. In meiner Vorstellung funktioniert die Gemeinschaft wie ein Magnet, der viele Leute anzieht, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und über die Gemeinschaft zusammenkommen und -arbeiten.
Welche Punkte sind euch denn generell am wichtigsten, die sich im gesamten Lebensmittelsystem ändern müssen?
S: Für die perfekte Welt?
Im Prinzip ja.
S: Da hängt vieles zusammen. Aus gastronomischer Sicht geht es da vor allem um die Produktauswahl, welche Leute wir einstellen und wie wir sie bezahlen, den Preis, den der Gast zahlt, mit dem wir letzten Endes unsere Rechnungen begleichen. Wir verfolgen einen bestimmten Ethos, den wir auch mit unserem zweiten Restaurant noch vergrößern. Und wir freuen uns, wenn wir damit andere Läden inspirieren, ähnlich zu handeln, um eine nachhaltigere Gastronomie zu schaffen.
L: Wir hatten mal den Gastrokritiker Bernd Matthies zu Gast, der bemängelt hat, dass man im Lode & Stijn nicht à la carte essen kann. Da frage ich mich, warum er unser Konzept nicht akzeptiert und es in dem Maße kritisiert. Wir haben uns ja ganz bewusst dafür entschieden, ein Menü anzubieten. Die Welt, die er sich wünscht, in der man sich alles aussuchen kann und alles ständig verfügbar ist, muss eigentlich viel teurer sein, als sie im Durchschnitt ist. Denn diese Welt kann nur durch schlechte Bezahlung, Schwarzgeld, schlechte Produkte und viel Abfall existieren.
S: Wenn mehr Gastronom:innen nur noch Menüs anbieten würden, würden die Gäste diesen Zustand viel eher akzeptieren, das Bewusstsein würde wachsen. Denn bei einem Menü brauchst du ein Konzept und kannst viel besser darauf achten, alles zu verwerten und zudem besser kalkulieren. Aber die Gäste müssen lernen, sich darauf mehr einlassen.
L: Da ist auf jeden Fall noch richtig viel Aufklärung nötig.
S: Und auch mehr Wertschätzung den Gastronom:innen gegenüber. Dafür, dass sie sich die Gedanken darum machen.
Fotos
Die Gemeinschaft, Sam Harris, Robert Rieger
Text und Bearbeitung
Carolin Foelster