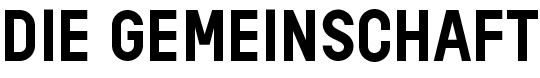Nobelhart & Schmutzig

Das Nobelhart & Schmutzig in Berlin-Kreuzberg stellt durch seine brutal-lokale Küche die Erzeuger:innen aus dem Berliner Umland in den Fokus. Billy Wagner, Inhaber, Wirt und Sommelier, und Micha Schäfer, Küchenchef des Restaurants, erzählen uns, was das für ihre tägliche Arbeit bedeutet, welche Bedeutung dem gemeinschaftlichen Austausch zukommt und wie ein breiterer Wandel innerhalb der Gastronomie aussehen kann.
Billy, mit welcher Motivation hast du das Nobelhart & Schmutzig gegründet?
Billy: Ich wollte den Zugriff auf gute Lebensmittel für mich als Privatperson sicherstellen, da ist es einfacher, wenn man ein Unternehmen hat, das lokale Lebensmittel einkauft. Und ich wollte jemanden haben, der mir tagtäglich Essen kocht, auch da ist es einfacher, wenn man ein Unternehmen hat, in dem Köch:innen beschäftigt sind, die das Essen zubereiten. Das Ganze ist recht kostspielig, daher muss es jemanden geben, der das bezahlt. Das sind die Gäste, die tagtäglich zu uns kommen. Damit sie zu uns kommen, haben wir ein für uns sehr sinnvolles Konzept erstellt, das auf der Art und Weise beruht, wie ich als Privatperson in den letzten 15-20 Jahren meine Lebensmittel bezogen habe. Nämlich auf dem Markt das einzukaufen, was zur Verfügung steht und daraus Dinge herzustellen. Die Nähe zum Produzenten war mir schon immer wichtig, die hat sich jetzt durch die Arbeit mit Micha an der Idee des Nobelhart & Schmutzig nochmal verstärkt. Das meine ich ganz ehrlich so, das ist kein Scherz. Eigentlich ein egoistischer Gedanke, den ich auch schon oft benannt habe – denn so ist es.
Micha, was macht die Küche des Nobelhart & Schmutzig aus?
Micha: Das Offensichtlichste ist, dass wir so kochen, wie wir kochen, nämlich brutal lokal. Wir orientieren uns ausschließlich an der Landwirtschaft um Berlin herum, dadurch kommen wir automatisch mehr mit den Menschen hinter den Erzeugnissen in Kontakt, anstatt dass wir nur in der Küche stehen und uns überlegen, was wir gerne kochen möchten. Der Gast, der zum Essen zu uns herkommt, macht hier die Erfahrung, wie es im Berliner Umland schmeckt – das ist die Essenz des Ganzen.
Gab es für euch überhaupt eine andere mögliche Vorstellung, das anders zu machen oder war das Konzept brutal lokal von Anfang an eure Vision?
B: Wir müssen uns ja von den knapp 8000 gastronomischen Betrieben, die es in Berlin gibt, unterscheiden. Zum Zeitpunkt unserer Gründung gab es kein Restaurant, dessen Küche brutal lokal gekochtt hat, wie wir das fokussiert haben. Der zweite Pfeiler des Konzepts Nobelhart & Schmutzig sollte sein, dass es eine Theke gibt, also dass man im Prinzip in der Küche sitzt und isst. Das gab es ganz vereinzelt schon, ich hatte mir im Vorfeld weltweit Läden mit Thekenkonzept angeschaut. Wir haben uns dann Gedanken um das Drumherum gemacht und haben versucht, alle Details durchzudeklinieren, immer mit der Frage im Hinterkopf, warum wir jetzt genau dieses und jenes einkaufen, brauchen und benutzen.
„Wir teilen die Dinge, die wir machen und gemacht haben mit anderen, um damit die Esskultur, von der wir immer sprechen, nicht nur in einem Restaurant, sondern auch in vielen weiteren Restaurants zu verändern.“
Ihr habt eine klare Rollenaufteilung im Restaurant. Was bedeutet das konkret für euch?
B: Ich bin dafür da, dass Gäste zu uns kommen. Die unser Konzept gut finden und genau deswegen herkommen und ihr Geld hierlassen, wovon wir dann wieder Dinge bezahlen können. Ich formuliere es gerne so: Micha guckt, dass die Gäste satt sind und ich gucke, dass überhaupt Gäste da sind. Das ist meine Aufgabe.
M: Die Rolle des Küchenchefs bedeutet für mich, nicht bloß zu kochen, sondern dass ich auch aufs Land rausfahre, um Landwirt:innen zu besuchen und mich mit ihnen darüber unterhalte, was es aktuell auf den Feldern gibt, welche Besonderheiten grade wachsen. Und um zu lernen und zu verstehen, was gute Landwirtschaft eigentlich ausmacht. Innerhalb dieser Arbeit und der ständigen Kommunikation untereinander ist die Notwendigkeit klar geworden, dass die Erzeuger:innen mit den Gastronom:innen unbedingt stärker miteinander vernetzt werden müssen, um überhaupt einen zukunftsfähigen Austausch zu haben. Ansonsten arbeitet jetzt jeder so zehn, fünfzehn Jahre vor sich hin, macht dann zu und das war’s dann.
Und wie gehst du auf die Leute zu, die noch keine Gäste des Nobelhart & Schmutzig sind, Billy? Sprich, wie werden sie Gäste?
B: Eigentlich tue ich erstmal gar nichts für den Gast. Ich mache nur das, wovon ich denke, dass es in dem Moment richtig ist. Damit sind wir für ganz viele Gäste auch völlig uninteressant. Denn eigentlich ist es ja in der Gastronomie so, dass erstmal alles für den Gast gemacht wird. Dieses typische Gastgeber sein. Ich sehe das so ähnlich, wie die Tatsache, dass ein Buchautor oder Theaterschauspieler auch nicht für seine Leser schreibt oder sein Publikum spielt. Wir arbeiten hier so, wie wir es für richtig erachten und hoffen, dass das genug Leute interessiert, die zu uns kommen. Gewisse Sachen, die der Gast anderswo bekommt, kann oder will ich nicht machen. Er kommt zu uns, weil er sich in gewisser Weise führen lassen möchte. Diejenigen, die herkommen, kommen auch oft wieder. Sonst würde es uns nicht bald seit sechs Jahren geben. Aber gleichzeitig kommen hier auch Menschen überhaupt nicht hin, da sie das alles von vorne bis hinten erstunken und erlogen finden. Und das ist auch in Ordnung.
Inwiefern spielt es für eure Gäste eine Rolle, dass ihr euch als politischstes Restaurant bezeichnet?
B: Das ist für den Gast erstmal egal, vielen ist es wahrscheinlich total wurscht. Für uns ist es wichtig, weil wir damit einen Fahrplan haben, was wir machen und was wir eben nicht machen. Und wie wir die Arbeit, die wir hier tun, rechtfertigen. Wir kommunizieren das zwar auch nach außen, aber es gibt viel mehr uns selbst die Möglichkeit, über Dinge nachzudenken und Themen zu stolpern, die unsere Arbeit interessanter und spannender machen, als einfach nur Essen und Getränke auszuschenken oder zu servieren.
Micha, brutal lokal heißt, mit den Erzeuger:innen aus dem engsten Umkreis zusammenzuarbeiten. Wie bist du mit ihnen in Kontakt gekommen?
M: Wir hatten hier etwa ein Jahr Vorbereitungszeit, in dem wir versucht haben, vieles anzustoßen. Zu der Zeit gab es hier wirklich wenige gute Erzeuger:innen im Umland, das hat sich erst nach und nach entwickelt. Sie zu finden war gar nicht so leicht, denn es gab nirgendwo so richtig gute Informationen. Manchmal wurde mir von bestimmten Höfen und Gärtnereien erzählt, ich hab aber auch Erzeuger:innen auf dem Markt angesprochen oder im Internet recherchiert. Die einzigen Anlaufstellen in der Stadt waren eigentlich der Wochenmarkt und die Markthalle. Oft musste ich dann feststellen, dass die Vertreiber:innen dort gar keine Landwirt:innen sind, sondern nur zukaufen. Die richtig guten Sachen haben sich dann über die Jahre haben meist durch Mundpropaganda ergeben, das Netzwerken ist in der Hinsicht echt essenziell, um vorwärts zu kommen.
Welches Ziel wollt ihr durch die enge Zusammenarbeit und den konstanten Austausch zwischen Gastronomie und Landwirtschaft erreichen?
M: Es geht vor allem um das größere Bild und um einen wirtschaftlichen Einfluss. Wir wollen, dass es noch viel mehr Gastronom:innen so machen wie wir, dass noch viel mehr Landwirt:innen so arbeiten wie beispielsweise David Peacock vom Erdhof Seewalde. Je größer dieses Netzwerk wird, desto stärker wird der wirtschaftliche Einfluss auf das System, desto eher bekommen die Restaurants der Stadt richtig gute Produkte, die dann wiederum Touristen anziehen, die erleben wollen, wie man hier essen kann. Nicht zuletzt würde auch die Landwirtschaft viel mehr Geld erhalten. Es ist ein System, das allerdings nur funktioniert, wenn sich mehrere Restaurants dran beteiligen, daher muss das unbedingt unterstützt werden. Weitere gute Nebeneffekte sind, dass man richtig gutes Essen in der Stadt bekommt und gute Produkte einkaufen kann, außerdem wird die Landwirtschaft diverser.
Wie kann das Netzwerk noch besser ausgebaut und vergrößert werden?
M: Was passieren darf, und in die Richtung treibt es ja auch die Gemeinschaft schon, ist die verstärkte Zusammenarbeit mit der Politik. Der Gesetzgeber muss am gleichen Strang ziehen wie wir, der stellt sich ja manchmal gerne quer, manchmal auch unabsichtlich. Und achtet einfach nicht darauf, dass es auch kleinen landwirtschaftlichen Betrieben gut geht. Außerdem ist Diversität innerhalb der Gruppe wichtig – dass sich nicht nur kleine, spezialisierte Landwirt:innen oder Gourmetrestaurants beteiligen, sondern auch Kantinen und große landwirtschaftliche Betriebe usw. Je diverser das Netzwerk ist, umso sicherer ist das Konzept regionaler Versorgung insgesamt gegen Einbrüche, Ausfälle oder Restaurantschließungen gewappnet. Daher finde ich es wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Leute dazukommen, um die ganze Bandbreite der Gastronomie und Landwirtschaft zu repräsentieren.
Hat sich für euch durch die Arbeit innerhalb der Gemeinschaft etwas verändert?
B: Wir geben mehr Geld aus, da alles erstmal etwas kostet. Wir haben mit der Gemeinschaft ein riesiges Fass aufgemacht, was aber dazu führt, dass wir viel mehr Austausch mit anderen haben und wir durch diesen Austausch auf der einen Seite profitieren, da wir so Neues lernen. Auf der anderen Seite andere auch von uns lernen und dadurch eine laufende Kommunikation entsteht. Wir teilen die Dinge, die wir machen und gemacht haben mit anderen, um damit die Esskultur, von der wir immer sprechen, nicht nur in einem Restaurant, sondern auch in vielen weiteren Restaurants zu verändern.
M: Zum einen hat sich ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt, ein Gefühl, dass wir gemeinsam etwas machen. Man ruft sich häufiger an, tauscht sich untereinander aus oder holt Sachen für andere Restaurants mit ab, wenn man eh zum:zur Erzeuger:in rausfährt. Einfachere Kommunikation, ohne Komplikationen und weniger Konkurrenzdenken. Durch die Gemeinschaft sind verschiedene Gastronom:innen an die gleichen Erzeuger:innen herangekommen. Dafür waren auch die Hofbesuche sehr wichtig, die die Gemeinschaft organisiert hat.
Wenn wir uns das große Bild anschauen, bemerken wir, dass sich bereits hier und da im Lebensmittelsystem nachhaltige Veränderungen vollziehen. In welchem Maße spürt ihr diese Veränderungen?
B: Ich merke, dass es ein großes Interesse an unserer Arbeit gibt, schon von Anfang an. Das was wir hier machen, gab es vor einigen Jahren so noch gar nicht in Deutschland. Das hat ja auch die Medien auf uns aufmerksam gemacht. Das Interesse spüren wir auch durch unsere Mitarbeitenden bzw. diejenigen, die es werden wollen, die hierherkommen und etwas suchen, etwas erwarten, gewisse Dinge mitbekommen wollen. Und auf der anderen Seite merken wir es auch daran, dass viele Kollegen auf uns schauen und gucken, was wir machen, um dann ähnliche Dinge zu tun wie wir. Genau das war auch immer gewollt, nämlich dass Leute uns kopieren. Deswegen sind wir so offen und transparent, teilen unsere Produzent:innen, veröffentlichen, wo wir was einkaufen. Wir machen Dinge, um andere anzuregen – ob das nun Vulven im Schaufenster sind oder Toiletten, die vereinheitlicht sind und nicht mehr nach Mann oder Frau unterteilt sind, um nur zwei Beispiele zu nennen.
M: Ich würde sagen, wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang, was eine nachhaltige Veränderung angeht. Seit ein, zwei Jahren gibt es junge Leute, die wirklich Lust haben, in der Gastronomie und Landwirtschaft etwas anders zu machen. So wie zum Beispiel der Otto (Inhaber des Berliner Restaurants Otto, Anm. d. Red.). Generell kann man in Berlin kein Restaurant mehr eröffnen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, wie und wo man einkauft. Die Frage kommt jetzt viel schneller als früher. Auch in der Landwirtschaft tut sich was, junge Leute haben gute Ideen und gründen Unternehmen, so zum Beispiel der Sohn von Olaf (Olaf Schnelle, Anm. d. Red.). Es gibt auf jeden Fall Interesse daran, auch landwirtschaftlich die Dinge neu zu denken, da hat sich schon eine Art Imagewandel vollzogen. Die Auswirkungen dessen, was da grade passiert, sehen wir aber erst in etwa fünf Jahren.
B: Die Einstellungen und Werte der jungen Menschen verändern sich, es wird vielmehr hinterfragt, wo wir einkaufen, welche Kleidung wir tragen, welches Waschmittel wir verwenden. Brauchen wir ein Auto oder nicht, welche Alternativen gibt es, oder ganz grundlegend: kann man sich überhaupt verändern? Welche Dinge sind überhaupt wichtig? So haben sich hier natürlich auch Dinge entwickelt, durch die verschiedensten Einflüsse.
„Die Rolle des Küchenchefs bedeutet für mich, nicht bloß zu kochen, sondern dass ich aufs Land rausfahre, um Landwirt*innen zu besuchen und mich mit ihnen darüber unterhalte, was es aktuell auf den Feldern gibt, welche Besonderheiten grade wachsen. Und um zu lernen und zu verstehen, was gute Landwirtschaft eigentlich ausmacht.“
Und was ist der größte Motor für einen breiteren Wandel innerhalb der Gastronomie?
B: Ich glaube, auch wieder aus wirtschaftlicher Sicht gedacht, wenn wir wirklich einen Wandel schaffen wollen, müssen wir erstmal eine Nachfrage erzeugen. Momentan gibt es im Berliner Umland zwei, drei Höfe, die gute Milch erzeugen. Vor fünf bis zehn Jahren war das vielleicht einer. Um diesen Wandel voranzutreiben, zu ermöglichen, dass es immer mehr gute Produkte gibt, müssen wir also überhaupt die Nachfrage nach guter Milch und insgesamt guten Produkten erhöhen. Da haben wir als Restaurant mit unseren achttausend Gästen eine gewisse Kraft, aber die natürlich noch viel höher ist, wenn es da noch mehr Restaurants gibt, die am gleichen Strang ziehen. Wenn es dann erstmal eine Nachfrage gibt, gibt es auch immer ein Angebot, das ist einfach so. So entsteht automatisch Wandel, was aber gleichzeitig nicht heißen muss, dass das bestehende schlecht ist, vielmehr heißt das, dass es auch noch etwas anderes gibt – dass es im Prinzip unterschiedliche Realitäten geben muss. Ähnlich wie beim Wein, wo es immer den Industriewein geben wird, um den Massengeschmack abzufertigen.
Welche Dinge müssen unbedingt weiter forciert werden?
B: Es muss gar nichts, vielmehr sollte sich jede:r Einzelne:r trauen, offen für Neues zu bleiben. Sich nicht davor zu verschränken, Dinge zu verändern, die man immer so gemacht hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie das Beispiel mit unseren Toiletten: Vor sechs Jahren war es völlig in Ordnung, Toilettenschilder für Frau und Mann hängen zu haben, die Frau war rot und trug einen Rock, der Mann in blau mit Hose. Was ja sinnbildlich dafür steht, dass die Frau hysterisch, der Mann unterkühlt ist. Das hat sich durch die Aktion unserer Vulven im Schaufenster und den damaligen Kontakt zu den Menschen, die das Projekt initiiert haben, einfach irgendwann überholt. Denn nur weil etwas so ist, wie es jetzt ist, heißt es ja nicht, dass es sich nicht verändern darf. Nicht stehen zu bleiben und sich auch immer wieder in Frage stellt, das ist wichtig. Wie kann man als Restaurant, auch unter den aktuellen Umständen durch die Coronakrise, weitermachen? Mache ich jetzt einfach zu, kaufe keine Lebensmittel mehr ein, schiebe kein Geld mehr ins Berliner Umland? Oder versuche ich mein Konzept umzustellen, um weiterhin einzukaufen und somit meine Produzent:innen unterstützen zu können? Auch da ist es wichtig, Dinge immer wieder zu hinterfragen. Offenheit gegenüber den unterschiedlichsten Themen zu haben und manchmal auch eine gewisse Abwehr zu haben – nicht alles, was man hört oder sieht ist automatisch gut. Eine gewisse Skepsis ist auch ganz wichtig.
Micha, wen siehst du in der Verantwortung für den weiteren Fortschritt der Veränderung?
M: Verantwortlich sind alle, die Lebensmittel kaufen. Aber die Politik kann das Ganze schon um einiges beschleunigen, wenn sie Geld hineinsteckt. Die Berliner Senatsverwaltung macht hier ja auch schon ein bisschen was, was großartig ist. Aber auf Bundes- und europäischer Ebene läuft das aktuell komplett in die falsche Richtung.
Welche Vision hast du für das Lebensmittelsystem insgesamt – wie wünscht du dir, dass es sich weiterentwickelt?
M: Es muss ganz klar eine Werteverschiebung geben. Dass die Leute noch viel stärker überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben, wenn sie Lebensmittel kaufen oder essen gehen. Auch bei finanziellen Schwierigkeiten, geringem Einkommen und mit Kindern kann das klappen, auch wenn es auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Hab ich alles schon erlebt und es geht trotzdem. Man muss halt kochen können. Der schwierigste Ort zum Kochen ist eine Schulkantine. Du hast erstens kein Geld, zweitens anspruchsvolle Eltern und drittens –als komplettes Gegenteil – komplett anspruchslose Kinder. Da auf einen Nenner zu kommen, ist der absolute Albtraum. Ein interessantes Ziel wäre wirklich gutes Essen in den staatlichen Schulen anzubieten. Denn das würde beinhalten, dass sowohl Caterer, als auch Eltern und Kinder, als auch die Politik dahinterstehen und genau das wollen würden. Und es bezahlen würden. Das würde die Wichtigkeit verdeutlichen und man würde einen Wendepunkt erreichen.
Fotos
Caroline Prange, Robert Schlesinger
Text und Bearbeitung
Carolin Foelster